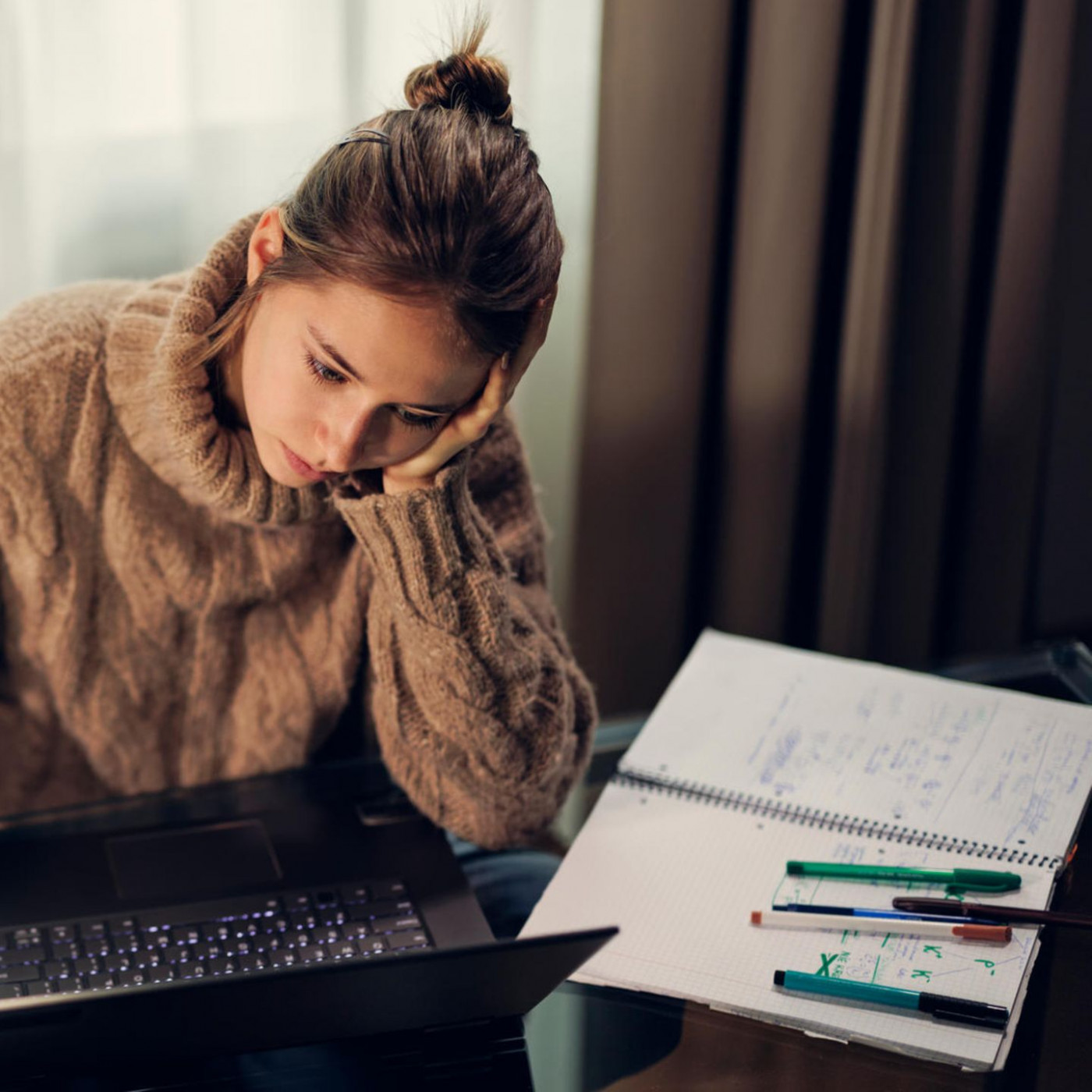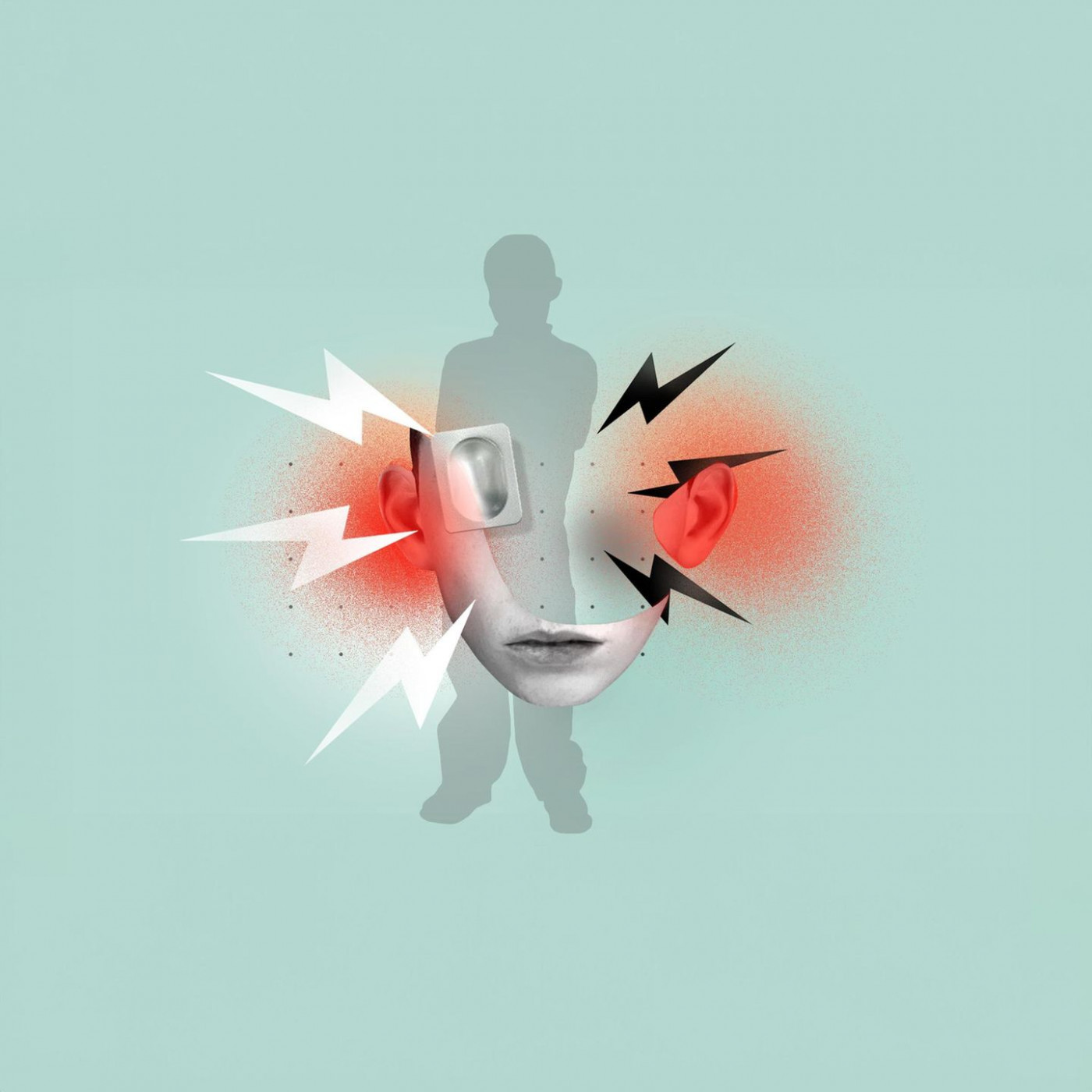Die Redensart ist altbekannt, aber sie besitzt einen tieferen medizinischen Sinn: Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen. Schon die antiken Ärzte wussten darum, wie sehr die Ernährung die Gesundheit beeinflusst; der wohl berühmteste, Hippokrates, pries sie gar als eigentliche Medizin. Umso paradoxer erscheint, dass heutzutage offenbar Tausende Krankenhaus-Patienten an Unterernährung leiden. Sie hungern quasi, denn ihnen fehlen Kalorien und Eiweiße. Schlimmer noch: Viel zu oft nimmt nicht einmal jemand Notiz davon. Das hat mitunter tödliche Konsequenzen.
„Mangelernährung im Krankenhaus ist kein Randproblem“, sagt Matthias Pirlich, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM). Erst kürzlich hat die Fachgesellschaft darauf hingewiesen, dass in deutschen Klinken jährlich 200.000 Patienten mit Mangelernährung als zusätzlichem Risikofaktor versterben – dabei könnten 55.000 von ihnen durch ein zeitgemäßes Ernährungsmanagement gerettet werden.
Zum Vergleich: Von den tödlich verlaufenden Krankenhausinfektionen lassen sich schätzungsweise lediglich einige Tausend mit guter Hygiene abwenden. „Unsere Zahlen sind nur grobe Hochrechnungen“, gesteht Pirlich ein – die Dimension des Problems sei allerdings realistisch. So legen Studien nahe, dass bis zu 30 Prozent aller Klinikpatienten zu schlecht ernährt sind und dadurch eine ungünstigere Prognose haben. Die Mangelernährung zeigt sich dabei in einem ungewollten Gewichtsverlust oder reduzierter Muskelmasse und geht eben weit über ein Zuwenig etwa von Vitaminen oder Spurenelementen hinaus.
Schon 2023 hatte die DGEM an das Bundesgesundheitsministerium appelliert, ein systematisches Screening auf Mangelernährung gesetzlich in den Krankenhäusern einzuführen. Zwei Dutzend weitere medizinische Fachgesellschaften schlossen sich der Stellungnahme an. Doch auch bei der nun anlaufenden Krankenhausreform steht das Thema bislang nicht auf der politischen Agenda, und ohne verpflichtende Vorgaben obliegt es jeder Klinik selbst, wie sorgfältig sie ihre Patienten ernährt.
Auf den ersten Blick scheint das Problem das berüchtigte Klinikessen zu sein: Hingeklatschter Kartoffelbrei und halb kalte Hackfleischsoße; labbriges Toastbrot mit eingeschweißtem Käse; Salatgarnituren, die aus zwei Gurkenscheiben und einer achtel Tomate bestehen – im Internet finden sich unzählige Bilder und Kommentare zur Krankenhauskost. Kein Wunder, dass da niemand wirklich zuschlägt.
Doch so mies, wie oft vermutet, ist das Essen offenbar gar nicht. Laut dem aktuellen Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist die Hälfte der Patienten mit dem Krankenhaus-Essen zufrieden oder sehr zufrieden, nur einer von sieben hält es für zu schlecht. Zwar beruhen die Zahlen auf freiwilligen Umfragen, doch zeigen sie immerhin, dass es viele Positivbeispiele gibt.
Mehr Eiweiß und Proteine für Patienten
Und selbst bei mäßigen Menüs, so Pirlich, „ließe sich viel gegen Ernährungsmängel tun“. Vor allem gehe es darum, bei vulnerablen Patienten besser hinzuschauen, bei den Älteren und chronisch Erkrankten, die oft nicht mehr ausreichend Essen zu sich nähmen und bereits mit Ernährungsdefiziten in die Klinik kämen. „Im Stationsbetrieb merkt dann häufig gar keiner, dass sie ein oder zwei Wochen kaum etwas essen“, sagt Pirlich. Nicht angerührte Speisen würden vom Essensdienst unbedacht wieder abgeräumt.
Dahinter verbirgt sich meist eine Verkettung von Gründen. Mitunter sitzt die Zahnprothese schlecht und das Kauen fällt schwer. Oft sind Patienten vereinsamt, das Einkaufen wurde zur Last, der Essensgenuss ist lange versiegt. Hinzu kommen die körperlichen Krankheiten. So drosseln gerade chronische Entzündungsprozesse, teils über neuronale Mechanismen, den Appetit und stoßen einen Stressstoffwechsel an, bei dem die Eiweißreserven angegriffen und die Muskeln abgebaut werden. Auch bei Übergewicht kommt dies – trotz trügerischer Leibesfülle – häufig vor.
Lange galt: An all dem lässt sich nicht viel ändern, schon gar nicht bei einem kurzen Klinikaufenthalt. „Tatsächlich ist das Potenzial der Ernährungstherapie jedoch enorm“, argumentiert Philipp Schütz, Chefarzt am schweizerischen Kantonsspital Aarau und inzwischen einer der meistgenannten Forscher in dem Feld. Bereits vor einigen Jahren hatte sein Team für mangelernährte internistische Patienten einen pragmatischen Ernährungsansatz entwickelt und in der bisher größten Interventionsstudie dieser Art getestet.
Für die Teilnehmer wurden bei der Klinikaufnahme individuelle Ernährungsziele insbesondere für Kalorien und Eiweiße definiert. Um sie zu erreichen, durften sie neben der üblichen Verpflegung auch eiweißreiche Milchshakes statt Fleisch bestellen, sie bekamen zusätzliche Trinknahrung, oder die Klinikküche mischte ihnen Proteinpulver ins Kartoffelpüree. Eine Gruppe von Kontrollpatienten erhielt dagegen Standardkost.
Zehn Tage währte im Schnitt der Aufenthalt auf Station – nach einem Monat stellten die Forscher fest, dass durch das Ernährungsmanagement jeder dritte Todesfall abgewendet worden war. Längst hat die Studie Experten weltweit zum Umdenken gebracht.
„Natürlich ist Mangelernährung meist ein chronisches Problem“, weiß auch Schütz. So hat eine nachfolgende Auswertung gezeigt, dass die Vorteile der stationären Ernährungstherapie binnen sechs Monaten wieder verschwinden und sich die Sterblichkeit angleicht. Die Forscher testen nun in einer neuen Studie, ob der Erfolg bewahrt werden kann, wenn man die Patienten ambulant weiterbetreut und ihnen zu Hause etwa Trinknahrung verschreibt.
Gute Ergebnisse aus Leipzig
Klar sei zudem, dass das Ernährungsmanagement in der Klinik abgestimmte Abläufe erfordert mit flexiblem Küchenpersonal und helfenden Händen auf den Stationen, die gebrechliche Patienten beim Essen unterstützen. Gleichwohl hält Schütz seinen Ansatz für alltagstauglich. So belegen die umfangreichen Patientendaten des Schweizer Statistikamts, dass eine ernährungsmedizinische Betreuung auch in der stationären Routineversorgung viele Todesfälle verhindert – und die Patienten zudem öfter nach Hause entlassen werden können statt in ein Pflegeheim.
Selbst ökonomisch betrachtet sei die Ernährungstherapie effektiv, ergänzt Schütz. In einer Modellrechnung haben die Forscher ermittelt, dass sie für Nahrungsmittel und Ergänzungspräparate sowie die Betreuung durch eine Diätassistentin rund 15 Schweizer Franken pro Patient und Tag zusätzlich aufwenden mussten – die Gesamtkosten der Behandlung aber geringfügig sanken. Denn bei den Teilnehmern gingen auch die Komplikationen zurück, und sie verbrachten weniger Tage auf der Intensivstation.
„Mit der Therapie der Mangelernährung lassen sich wahrscheinlich viele negative Folgen vermeiden“, bestätigt Gerald Gaß, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ein strukturelles Problem gebe es jedoch, meint Gaß: Die Einspareffekte, die entstehen, wenn Patienten beispielsweise nicht so schnell pflegebedürftig werden, entlasten zwar das Gesundheitssystem als Ganzes – aber nicht unbedingt die Klinik, die den Aufwand betreibt.
So erhalten die Häuser für jeden Patienten eine Fallpauschale, aus der sie die gesamte Behandlung inklusive Verpflegung bestreiten. Die Pauschale erhöhe sich bei einem mangelernährten Patienten aber oft gar nicht oder nur so wenig, dass sie kaum kostendeckend sei, moniert Gaß. Das bedeutet: Die Kliniken – von denen ohnehin die meisten mit roten Zahlen kämpfen – werden für gutes Ernährungsmanagement mitnichten finanziell belohnt.
15,71 Euro einschließlich Personalkosten gaben deutsche Krankenhäuser 2021 je Patient und Tag für die Verpflegung aus, davon 5,32 Euro für Lebensmittel und Getränke – für sämtliche Mahlzeiten. Obwohl die Aufwendungen seither gestiegen sein dürften, bleibt kaum Spielraum für die Ernährungstherapie.
Das Uniklinikum Leipzig hat sie sich gleichwohl zum Programm gemacht. Bei allen seiner rund 50.000 erwachsenen Patienten pro Jahr wird bei der Aufnahme mit einfachen Fragen ermittelt, ob ein Mangelernährungsrisiko besteht. „In rund 10.000 Fällen schauen wir dann genauer hin, und bei mehr als 6000 Patienten intervenieren wir auch“, berichtet Lars Selig, der das Ernährungsteam am Klinikum leitet.
Nach dem Vorbild der Schweizer Interventionsstudie erhalten viele etwa zusätzliche Trinknahrung, auch wird das Essen von Büfett-Wagen und nicht per Tablettsystem auf den Stationen verteilt, um auf Wünsche eingehen zu können. Dabei kümmere sich mehr als die Hälfte seines 17-köpfigen Teams allein um die mangelernährten Patienten, verdeutlicht Selig.
Kürzlich hat das Leipziger Klinikum mit der Techniker Krankenkasse (TK) in Sachsen dazu einen „Qualitätsvertrag Mangelernährung“ geschlossen: Er soll die erhöhten Personalkosten und die Evaluation des Ernährungsscreenings in den kommenden Jahren abdecken. Qualitätsverträge, die es etwa auch beim Gelenkersatz oder in der Geburtsmedizin gibt, sind gesetzlich verankerte – aber freiwillige – Vereinbarungen zwischen Kliniken und Kassen, um neue Versorgungsansätze in Pilotprojekten zu erproben. Für jeden TK-Versicherten, den das Leipziger Uniklinikum ernährungsmedizinisch betreut, erhält es laut der TK einen „mittleren dreistelligen Zusatzbetrag“.
Überraschend genug: Bundesweit haben nur drei weitere Krankenhäuser vergleichbare Verträge. Für Mangelernährung sind sie erst seit 2024 möglich, doch scheuen Krankenkassen und Klinikdirektoren offenbar auch vor dem bürokratischen Aufwand zurück. „Viele wollen mit dem Ernährungsmanagement einfach keine weitere Baustelle aufmachen“, sagt Selig. Auch begegne man noch immer der Haltung, „dass ein Patient, der Hunger hat, sich melden soll“.
Außer Frage steht: Mangelernährung ist als medizinisches Problem präsenter geworden, es bewegt sich etwas in der Ärzteschaft. Eine aktuelle Studie aus Baden-Württemberg etwa belegt, dass die Zahl der Ernährungsteams in den Kliniken zuletzt erheblich zugenommen hat. Völlig angekommen im Versorgungssystem ist das Thema aber gleichwohl nicht. „Lass Nahrung deine Medizin sein“ – so schrieb es der antike Hippokrates. Seine Botschaft ist noch aktuell.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke