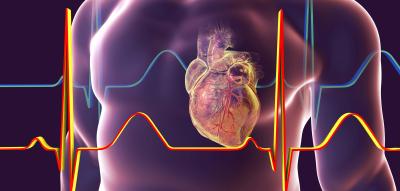Sie saß gerade mit ihrem Mann Justin beim Frühstück, als ein „merkwürdiges Gefühl“ von ihrer Schulter durch ihren Arm in ihre Fingerspitzen wanderte, bis diese taub wurden, erzählte die damals 26-jährige Hailey Bieber, Top-Modell und Star, vor zwei Jahren in der „Vogue“. „Ich bekam keinen Satz mehr hervor. Alles sprudelte wild heraus, nicht einmal durcheinander, ich konnte einfach keine Wörter mehr aussprechen“, sagt sie in einem Instagram-Video. „Dann begann meine rechte Gesichtshälfte herunterzuhängen.“
Die junge Frau hatte damals einen Schlaganfall, unter anderem, weil sie ohne ärztliche Beratung auf eine neue Antibaby-Pille umgestellt hatte. Ihr Fall verlief glücklich, sodass sie nach wenigen Stunden wieder symptomfrei war. Doch nicht mehr sprechen zu können, gehört zu den häufigsten Langzeitfolgen eines Schlaganfalls. Um diese Fähigkeit wiederzuerlangen, könnten bald Gehirn-Implantate helfen. Diese Technologie gilt in der Neuromedizin mittlerweile als große Hoffnung.
In der Fachzeitschrift „Nature Neuroscience“ veröffentlichten nun Neurologen der University of California in San Francisco Ergebnisse einer laufenden klinischen Studie zu einem neuen Gehirn-Implantat. Derzeit führen die Forscher Tests an drei Patienten durch. Eine Studienteilnehmerin erhielt bereits eine sogenannte Gehirn-Computer-Schnittstelle (GCS), über die eine Maschine ihre Gehirnaktivität auslesen und in Worte umwandeln kann. Die Frau hatte nach einem Schlagfall ihre Sprache verloren.
Jedes Jahr erleiden nach Schätzungen der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Etwa jeder siebte von ihnen ist unter 55 Jahre alt. Anzeichen auf einen Schlaganfall sollten so schnell wie möglich erkannt werden, denn Auslöser ist meist der Verschluss einer Arterie im Gehirn. Dadurch werden Nervenzellen nicht mehr mit Blut versorgt und sterben - bis zu 1,9 Millionen Gehirnzellen pro Minute.
Typische Anzeichen sind plötzliche Taubheit auf einer Körperseite oder Lähmung einer Gesichtshälfte, plötzlicher extremer Kopfschmerz oder undeutliche Sprache.
Abgesehen von diesen Fällen gibt es für Gehirn-Implantate dieser Art ein breites Anwendungsfeld. Von neurodegenerativen Erkrankungen wie amyotrophe Lateralsklerose über körperliche Lähmungen, bis hin zu Epilepsie und Depressionen. So zeigen sich bereits kurz vor einem epileptischen Anfall ungewöhnliche Gehirnaktivitäten, die von einer GCS registriert werden können, um dann durch gezielte Stimulation gegenzusteuern.
Das Konzept der GCS ist nicht neu. Doch die Ergebnisse der Studie seien ein „deutlicher Fortschritt“ hin zu nutzbaren Sprechhilfen, sagt Simon Jacob, Professor für Translationale Neurotechnologie an der Technischen Universität München. Entscheidend sei die Geschwindigkeit, mit welcher die elektrischen Signale der Hirnrinde in Text umgewandelt würden.
Die neuen Dekodier-Algorithmen würden achtmal schneller als bislang funktionieren. Bis ein Satz entschlüsselt und auf dem Bildschirm zu sehen war, dauerte es in früheren Versuchen wohl bis zu 23 Sekunden. Ein gewöhnliches Gespräch war damit kaum möglich. Der neue Algorithmus benötigt dagegen lediglich eine Sekunde, liest die Gedanken also beinahe in Echtzeit aus.
Mensch denkt, Maschine übersetzt
Das in der kalifornischen Studie verwendete neue Gerät wurde im Schädel der Patientin auf das motorische Sprachzentrum ihres Gehirns aufgesetzt. Mit 253 Elektrodenkanälen misst es die elektrische Aktivität der Hirnregion, während die Studienteilnehmerin sich vorstellt, Wörter auszusprechen.
Um das KI-Modell zu trainieren, formulierte sie still vorgegebene Sätze aus einem Wortschatz von 1024 Wörtern. Ein Synthesizer wurde mit alten Tonaufnahmen aus der Zeit vor ihrem Schlaganfall auf ihre Stimme trainiert. So konnten die Gedanken der Patientin anschließend Wort für Wort ausgegeben werden, mit bloß minimaler Verzögerung. Sie konnte wieder „sprechen“.
Auch hierin soll ein Fortschritt des neuen Modells liegen. So mussten Probanden bei früheren Geräten immer erst ganze Sätze in Gedanken formulieren, damit diese erkannt wurden. Nun soll das Gerät die Gehirnaktivität kontinuierlich, noch während des Formulierens, verarbeiten und eine unmittelbare, gleichberechtigte Teilhabe an Gesprächen ermöglichen.
Ein Durchbruch hin zu einer breiten Nutzbarkeit ist mit dem neuen Sprachgerät allerdings weiterhin nicht gelungen. Simon Jacob sagt dazu: „Wichtig ist, dass der Schlaganfall dieser Patientin eher untypisch ist.“ Denn es wurde ein bestimmter Bereich im Hirnstamm beschädigt, der lediglich dafür zuständig ist, die Sprechbewegungen auszuführen.
Die eigentliche gedankliche Planung der Sprechlaute findet allerdings in der motorischen Hirnrinde statt, die bei dieser Patientin nicht beschädigt wurde. Daher hat sie zwar eine Sprechstörung, aber keine Sprachstörung.
Demnach werden die gezeigten Erfolge nur für wenige Betroffene nutzbar sein. Die Mehrzahl der Schlaganfallpatienten mit Kommunikationsschwierigkeiten hat eine Sprachstörung. Surjo R. Soekadar, der die Arbeitsgruppe Klinische Neurotechnologie an der Berliner Charité leitet, bedauert, dass gerade diese Patientengruppe für solche experimentellen GCS-Studien gemieden würden.
Das Problem: Der Aufwand für Studien sei enorm, das Risiko zu scheitern aber auch. „Es besteht die Sorge, dass ein Misserfolg nicht nur die allgemeine Begeisterung für BCIs, sondern auch das Investitionsinteresse von Venture-Capital-Gebern verringern könnte“, sagt Soekadar. Denn neben medizinischem Fortschritt geht es bei Gehirn-Computer-Schnittstellen auch um viel Geld.
Der US-Finanzdienstleister Morgan Stanley schätzte im Oktober 2024, dass allein der US-Markt für medizinische Gehirn-Chips in einigen Jahrzehnten auf 400 Milliarden US-Dollar wachsen könnte. Auf Deutschlands Bevölkerungsgröße gerechnet entspricht das knapp 90 Milliarden Euro. Mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro im Jahr 2024 steht der globale Markt demnach am Anfang.
Deutsche Forschung ausgebremst
Entsprechend intensiv wird weltweit in dem Gebiet geforscht. Spitzenreiter ist bislang das US-Unternehmen „Synchron“, zu dessen Investoren die Tech-Milliardäre Jeff Bezos und Bill Gates gehören. Zehn erfolgreiche Implantationen kann das Start-up bereits vorweisen. Doch chinesische Firmen holen auf.
Am vergangenen Montag verkündete das chinesische Unternehmen NeuCyber NeuroTech, dass es im vergangenen Monat in Zusammenarbeit mit dem Chinesischen Institut für Gehirnforschung drei semi-invasive Implantate eingepflanzt hat. Bis Ende des Jahres sollen weitere zehn Operationen geplant sein. Somit würde die staatlich-unternehmerische Kooperation aus China die weltweite Führung übernehmen.
Mit Blick auf Deutschland weist Rüdiger Rupp auf einen zentralen Wettbewerbsnachteil des hiesigen Forschungssystems hin: Gesetzliche Vorschriften und lange Bewilligungsverfahren ersticken experimentelle State-of-the-Art Forschung bereits im Keim. Rupp leitet die Sektion Experimentelle Neurorehabilitation an der Klinik für Paraplegiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Besonders für Forscher an öffentlich finanzierten Instituten sei es „fast unmöglich, solche aufwendigen Studien mit implantierten Medizinprodukten in einem frühen Entwicklungsstand durchzuführen“.
Ob Deutschland an dieser technologischen Revolution künftig mit eigenen Entwicklungen teilhaben kann, ist somit – trotz traditionell starker universitärer Forschungsnetzwerke – ungewiss.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke